

Sichtbar für einen Tag
Zum Welt-Down-Syndrom-Tag steigen jedes Jahr die Medienanfragen zum Thema. Doch das Interesse ist flüchtig, ebenso wie bei anderen Gedenktagen. Was fehlt, ist Tiefe, Nachhaltigkeit – und Empathie.
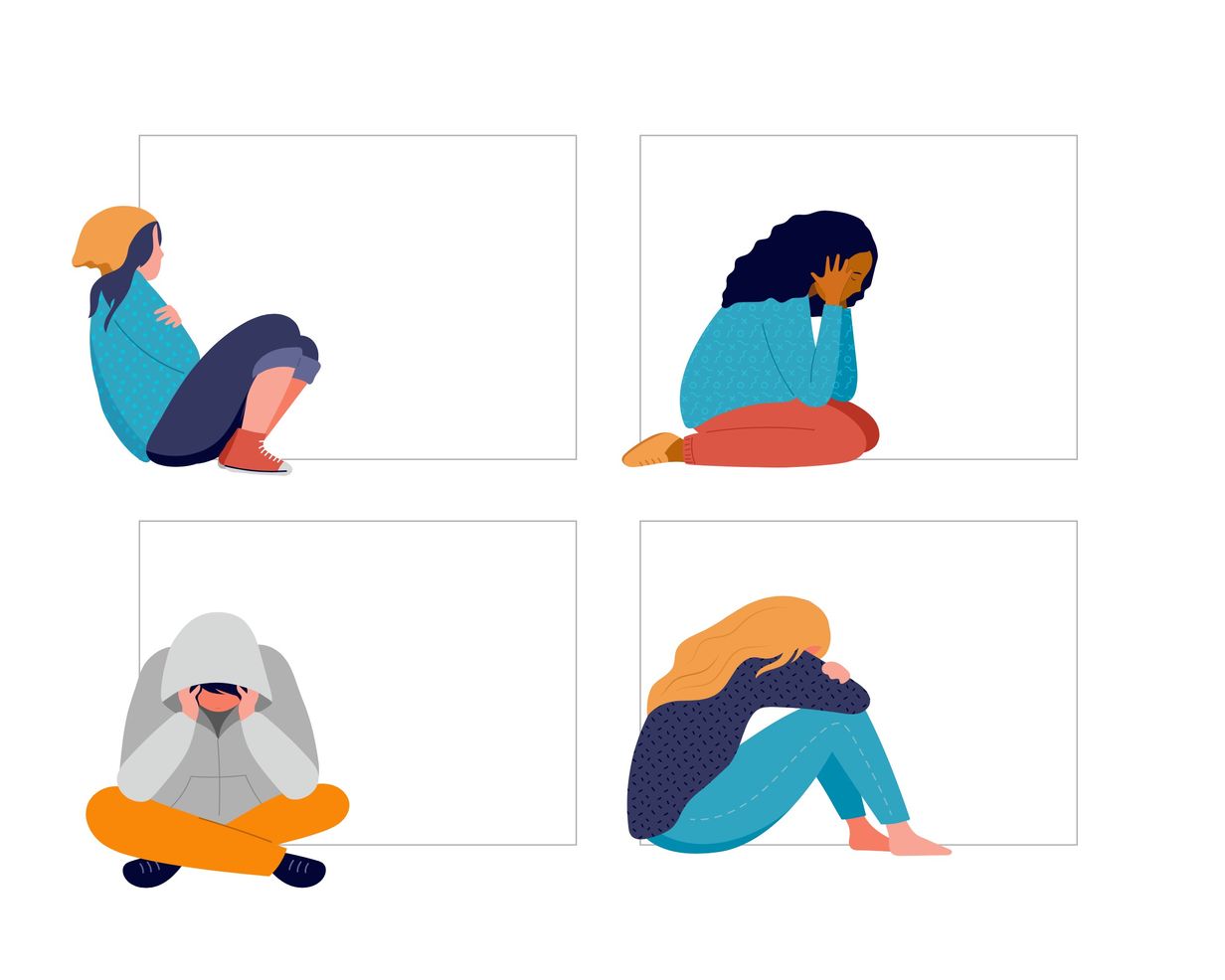
Die Maus hat Angst. Forschende reichern ihre Atemluft mit Kohlendioxid an oder erwärmen den Boden. All das geschieht in einem Maß, das gewöhnlichen Mäusen wenig ausmachen würde. Aber diese Labormaus ist anders. Sie ist überempfindlich und reagiert panisch. Damit verhält sie sich wie eine Gruppe weiterer Versuchstiere – und ist zugleich systematisch verschieden von einer Kontrollgruppe.
Soweit scheint das ein gewöhnliches verhaltensbiologisches Experiment zu sein. Kurios ist aber, dass die auffällige Gruppe und die Kontrollgruppe gleich aufgewachsen sind und unter identischen Bedingungen leben. Woher stammt dann bloß der Unterschied? Selbst die direkten Vorfahren aller Versuchstiere wurden gleich behandelt. Nur bei den Großvätern findet sich ein Unterschied: Diese mussten sich bei der einen Gruppe als Jungtiere vier Tage hintereinander täglich an ein neues fremdes Muttertier gewöhnen. Für die Mäuse ein vergleichsweise sanftes, aber offenbar nachhaltiges Trauma.
Doch kann es wirklich sein, dass dieses Ereignis noch zwei Generationen später nachwirkt? ___STEADY_PAYWALL___ Ist es möglich, dass eine Maus besonders ängstlich ist, weil ihr Urahn in früher Jugend schlimme Erfahrungen machen musste? Inzwischen gibt es eine Vielzahl von Studien, die exakt diesen Zusammenhang nahelegen. Eine wachsende Zahl von Therapierenden möchte Menschen sogar von den Traumata der Vorfahren befreien. Dabei ist umstritten, ob die Erkenntnisse auf uns übertragbar sind, wie man die Effekte misst und vor allem: wie man sie – sofern existent – systematisch und erfolgreich behandeln kann.
Egal bei welcher Art von Nagetier Forschende schauen, egal mit welcher Art von stark prägendem Umwelteinfluss sie experimentieren: Immer wieder finden sie Hinweise, dass diese Prägungen vererbt werden können. Seien es fehlernährte oder leicht vergiftete Ratten, schwach überhitzte Meerschweinchen oder traumatisierte Mäuse: Der jeweilige Reiz verändert offenbar nicht nur das betroffene Tier, sondern beeinflusst auch die Gesundheit der folgenden Generationen – und das, obwohl diese dem Auslöser ihrer Prägung nie begegneten.
Erst kürzlich publizierte ein italienisch-kanadisches Team um Marco Battaglia im Fachblatt Science Advances die Resultate mit den ängstlichen Mäusen. Verantwortlich für die Panik der Tiere ist in allen drei Generationen eine Veränderung in bestimmten Nervenzellen des Gehirns. Dort ist die sogenannte Epigenetik einiger Gene abgewandelt. Der DNA-Code dieser Gene ist zwar unbeeinflusst, aber sie können wegen kleiner biochemischer Umbauten in ihrer Umgebung besonders leicht abgelesen werden. Das macht die Nervenzellen erregbarer, was letztlich die Überempfindlichkeit der Tiere erklärt.
Spannend ist nun, dass alle drei Generationen dieselbe epigenetische Besonderheit aufweisen. Panik und Schmerz lassen sich zudem bei den Tieren aller drei Generationen durch das Inhalieren eines Sprays verhindern, das die Wirkung eines epigenetisch verstärkten Genprodukts dämpft. Die Forschenden hoffen sogar, ein neuartiges Mittel im Kampf gegen Angst- und Schmerzstörungen auch bei Menschen entdeckt zu haben. Das Spray namens Amilorid ist ein etabliertes Entwässerungsmedikament.
Doch wie haben die Mäuse die Information, dass ausgerechnet diese Nervenzellen an dieser Stelle epigenetisch verändert sein sollen, an ihre Kinder und Enkel weitergegeben? Sie ist ja nicht in der DNA gespeichert. Und schon gar nicht in der Keimbahn, also in Samen- oder Eizellen. Und sie stammt zumindest im Experiment lediglich von den Vätern. Die aber hatten keinerlei direkten Kontakt mit ihren Nachkommen.
Hier werden Forschende schmallippig: Die generationsüberschreitende epigenetische Übertragung von Umweltanpassungen sei bei Säugetieren eingeschränkt, schreibt Battaglia: „Wir interpretieren unsere Ergebnisse deshalb nur als Hinweis, dass sie durch epigenetische Mechanismen erklärt werden können, aber nicht als unumstößlichen Beweis.“
Bei Pflanzen, Würmern oder Fliegen ist längst belegt, dass sie nicht nur die DNA vererben, sondern auch deren nebengenetische, die Ablesbarkeit der Gene regulierende epigenetische Markierungen. Bei Säugern und noch viel mehr bei Menschen ist das hochumstritten. Säugetiere programmieren die Epigenetik ihrer Keimbahn zweimal zurück: erstens, wenn sie Ei- oder Samenzellen bilden, zweitens direkt nach der Befruchtung. Umweltanpassungen werden sozusagen wiederholt auf null gesetzt, damit das neue Leben unbelastet starten kann.
Immerhin zeigen Studien, dass diese „Reprogrammierung“ nicht immer vollständig ist. Und es gelang ebenfalls im Experiment mit Mäusen, befruchteten Eizellen so etwas wie epigenetische Botenstoffe mitzugeben, sogenannte Mikro-RNAs. Diese scheinen – wie auch immer – im Zuge der Entwicklung des neuen Organismus in den passenden Zellen Anweisungen für eine neue, zielgerichtete Ausrichtung der epigenetischen Regulation der Gene zu liefern. Der Neurobiologin Tracy Bale von der University of Pennsylvania, USA, gelang es sogar, allein durch die Gabe von neun künstlich hergestellten Mikro-RNAs in eine befruchtete Eizelle verhaltensauffällige Mäuse zu erzeugen. Die gleichen Mikro-RNAs hatte sie zuvor in den Spermien traumatisierter Tiere aufgespürt.
„Es ist denkbar, dass auch die Folgen einer Trauma-Exposition von Menschen an ihre Kinder oder sogar Enkelkinder weitergegeben werden.“ Isabelle Mansuy
„Wir verstehen noch nicht ganz, wie epigenetische Veränderungen in der Keimbahn und über die gesamte Entwicklung hinweg bestehen bleiben können“, sagt Isabelle Mansuy, Neuro-Epigenetikerin an der Universität und ETH Zürich. Auch sie zeigte mit ihrem Team die generationsüberschreitende Weitergabe epigenetischer Informationen per RNAs bei Mäusen. Das würde zusammen mit der teils unvollständigen Reprogrammierung immerhin erklären, wie die direkte epigenetische Weitergabe der Folgen eines Traumas von Eltern an ihre Kinder funktioniert. Völlig offen bleibt aber trotz intensiver Forschung, wie das Gleiche über mehrere Generationen hinweg passiert.
Mansuy arbeitet seit etwa 20 Jahren mit Mäusen, die traumatischem Stress ausgesetzt sind, und deren Nachkommen. Vergangenes Jahr gelang ihr der Nachweis, dass manche Effekte eines frühkindlichen Traumas bei den Nagern sogar über fünf Generationen auftreten können. Erst in der sechsten Generation fand das Team nichts Auffälliges mehr. Es sei also „denkbar, dass auch die Folgen einer Trauma-Exposition von Menschen an ihre Kinder oder sogar Enkelkinder weitergegeben werden“.
Allerdings geht es dabei nicht um konkrete Verhaltensweisen oder Ängste der Eltern. Diese sind in den Verknüpfungen des Nervensystems als Gedächtnis gespeichert und werden durch das Verhalten oder die Einstellungen der Eltern übertragen. „Wenn ein Elternteil Angst vor Spinnen hat, wird es dies zum Ausdruck bringen, es zeigen und darüber sprechen“, erklärt Mansuy. „Das Kind wird dieser Angst ausgesetzt sein und sie wahrscheinlich spüren und dann Spinnen mit Angst assoziieren.“ Kindern genügt mitunter ein eindrücklicher Moment, um die Angst der Eltern zu übernehmen. Die Eltern bekommen davon meist nichts mit.
Was aber vererben die traumatisierten Mäuse dann? „Einige der molekularen Veränderungen, die durch das Trauma hervorgerufen werden“, antwortet die Zürcherin. Diese sind am Entwicklungsprozess der nächsten Generation beteiligt und können den Ausgangszustand bestimmter Körperzellen so verändern, dass diese empfänglicher für die verschiedensten – positiven wie negativen – Einflüsse werden. Das bedeutet aber auch: Das Trauma der Eltern prägt deren Kinder ein Stück weit auch auf molekularbiologischem Weg.
Die Nachkommen traumatisierter Mäuse zeigen daher oft die gleichen Symptome wie ihre exponierten Eltern. Je nach Kontext können sie aber auch auffallend widerstandsfähig und weniger stressanfällig sein. Und häufig kommt es zu Stoffwechselstörungen, einer Art Diabetes und Herzschwäche.
Übertragen auf den Menschen wäre der Ausgangspunkt einer solchen Reaktionskaskade zum Beispiel, dass jemand aufgrund von chronischem Stress in der Kindheit oder wegen traumatisierender Kriegserfahrungen später im Leben Probleme mit der Regulation seiner Stresshormone hat. Das ist ein gut erforschtes Phänomen und lässt sich mit Veränderungen der Epigenetik in Körperzellen erklären. Als Folge entstehen nicht selten Depressionen oder ein metabolisches Syndrom mit Diabetes, Bluthochdruck und Übergewicht. „Und solche Risiken könnten sich über epigenetische Veränderungen in den Keimzellen verankern“, sagt Mansuy. „In diesem Fall könnten die Veränderungen bei der Befruchtung an den Embryo weitergegeben werden und dann vielleicht auch bei den Nachkommen Symptome hervorrufen.“
Für Nagetiere aller Art wurde diese Risiko-Kette mehrfach von verschiedensten Forschungsgruppen nachgewiesen. Unklarheiten bestehen vor allem bei den zugrunde liegenden epigenetischen Mechanismen. Doch auch hier macht das Gebiet Fortschritte: Juan Carlos Izpisua Belmonte vom Salk Institute in La Jolla, Kalifornien, veröffentlichte im Frühjahr mit seinem Team im Fachblatt Cell eine viel beachtete Studie. Die Forschenden veränderten zunächst gezielt die Epigenetik von embryonalen Mäusestammzellen und pflanzten diese in Leihmütter ein.
Dann verfolgten sie über mehrere Generationen, was mit den nebengenetischen Markierungen – in diesem Fall an die DNA angelagerte Methylgruppen (CH-3) – geschah: Zunächst verschwanden sie im Zuge der Reprogrammierung aus der Keimbahn. Aber dann wurden sie kurze Zeit später von den Zellen des neuen Embryos erneut angebaut. „Diese Beobachtungen sind ein konkreter Schritt zum Nachweis der transgenerationalen epigenetischen Vererbung bei Säugetieren“, schreiben die Forschenden.
„Die Vererbung von erworbenen Merkmalen bei Säugetieren ist ein höchst umstrittenes Thema.“ Bernhard Horsthemke und Adrian Bird
Die erfahrenen Epigenetiker Bernhard Horsthemke aus Essen und Adrian Bird aus Edinburgh sind skeptisch. „Die Vererbung von erworbenen Merkmalen bei Säugetieren ist ein höchst umstrittenes Thema“, geben sie in einem Kommentar zu bedenken – und nennen alternative Szenarios für den beobachteten Effekt. Wie der Disput enden wird, bleibt vorerst offen. Genauso wie die Frage, ob und wie man all das wirklich auf den Menschen übertragen kann. Das pathologische Verhalten depressiver oder psychisch instabiler Eltern wirkt sich natürlich auch direkt auf deren Kinder aus. Nur im Experiment wäre es möglich, beide Einflüsse voneinander zu trennen. Und ein solches Experiment verbietet sich bei Menschen.
Ein paar Hinweise liefern Untersuchungen zur Epigenetik von Holocaust-Überlebenden und ihren Kindern. Es zeigte sich, dass verschiedene Gene, die eine Rolle bei der Regulation von Stresshormonen und des Immunsystems spielen, bei den Betroffenen tatsächlich epigenetisch verändert sind. Die Überlebenden selbst machte diese Veränderung besonders widerstandsfähig, bei ihren Kindern ist aber der gegenteilige Effekt zu beobachten. Das könnte erklären, wieso Nachfahren von Holocaust-Überlebenden ein erhöhtes Risiko haben, an posttraumatischen Belastungsstörungen, Depressionen oder Ängsten zu erkranken, folgern die Autorinnen, darunter Elisabeth Binder vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München und Rachel Yehuda vom Mount Sinai Hospital in New York.
Angesichts der aktuellen Kriege in der Ukraine sowie in Israel und Gaza drängt sich die Frage auf, was all diese Erkenntnisse für Betroffene bedeuten. Die gute Nachricht ist, dass epigenetische Anpassungen in der Regel umkehrbar sind. Bei Mäusen gelingt es, mit artgerechten „therapeutischen“ Maßnahmen die Vererbung der Risiken zu unterdrücken. Sogenannte Epigenetik-Coaches verdienen schon heute ihr Geld damit, auch Menschen von den vermeintlichen Kriegstraumata ihrer Groß- und Urgroßeltern zu erlösen. Was sie dabei genau bekämpfen, ist unklar, denn das eigentliche Trauma, die konkrete Angst können ja nicht vererbt werden.
Umso wichtiger wird also die Prävention, die offenbar nicht früh genug ansetzen kann. Aus Kriegsgebieten geflüchtete Kinder und Erwachsene sollten möglichst schnell und möglichst effektiv behandelt werden, damit das Risiko einer Folgestörung sinkt. Denn deren Auftreten belastet nicht nur die Betroffenen selbst, sondern erhöht wahrscheinlich auch das Erkrankungsrisiko der Nachkommen.
Dieser Text ist zuerst auf RiffReporter erschienen.
Nur mit deiner Unterstützung, deinem regelmäßigen Mitgliedsbeitrag, können wir unabhängig recherchieren und sorgfältigen Journalismus machen.
Jetzt Mitglied werden

Zum Welt-Down-Syndrom-Tag steigen jedes Jahr die Medienanfragen zum Thema. Doch das Interesse ist flüchtig, ebenso wie bei anderen Gedenktagen. Was fehlt, ist Tiefe, Nachhaltigkeit – und Empathie.


In ihrem Buch „Digitale Diagnosen“ verhandelt die Soziologin Laura Wiesböck den legeren Umgang mit (Selbst-)Diagnosen und psychologischen Fachbegriffen heute.


Aber ich hätte immer noch ADHS und wahrscheinlich würde es mir schlechter gehen.


Nach Berechnungen der Europäischen Umweltagentur verursachen Unternehmen wie voestalpine, OMV oder Wien Energie hohe Kosten für die Gesellschaft. Da bei der Meldung der Daten geschlampt wurde, sind die Kosten in Wahrheit sogar noch höher.


Jede fünfte Mutter ist im Burnout oder akut Burnout gefährdet. Wie die Belastung von Eltern sinken kann, ohne die Bindungsbedürfnisse der Kinder zu gefährden, erklärt Nora Imlau im Interview.


Laut Schätzungen gibt es mehr als 42.000 sogenannte Young Carers in Österreich. Doch wer kümmert sich um diese Kinder und Jugendlichen, die sich schon in jungen Jahren um andere kümmern?