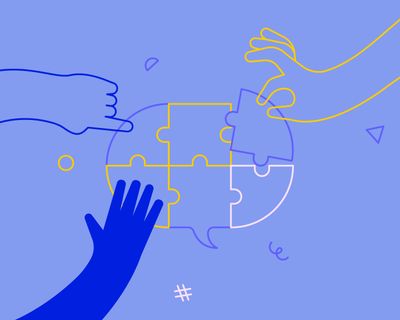Der kämpferische Kolaric
50 Jahre ist es her, dass eine heute noch berühmte Plakatkampagne für Toleranz gegenüber „Gastarbeiter*innen“ warb. Was würde Kolaric, der zur Symbolfigur für den „Gastarbeiter“ wurde, heute sagen?
Wien 1973. In der Stadt erregt eine Plakatkampagne Aufsehen. Das Sujet: ein Knirps in Lederhosen, der zu einem Mann in Anzug und Kappe aufblickt. Darunter der Text: „I haaß Kolaric, du haaßt Kolaric. Warum sogns’ zu dir Tschusch?“ Der großgewachsene Mann, der auf dem Plakat zu sehen ist, heißt tatsächlich Kolaric. Er ist ein „Gastarbeiter“ aus dem ehemaligen Jugoslawien, der im Schlachthof St. Marx beschäftigt ist.
Mit dem Sujet, das von der Werbewirtschaft Österreich für deren Aktion „Mitmensch“ in Auftrag gegeben wurde, will man für Toleranz gegenüber den hiesigen „Gastarbeiter*innen“ werben. Bis heute ist es einer der bekanntesten öffentlichen Beiträge zum Thema Rassismus in Österreich. ___STEADY_PAYWALL___ Das Plakat ist so populär, dass es später weitere Imagekampagnen inspiriert und in Schulbüchern abgebildet wird. Bald wird „Kolaric“ zum allgemeinen Synonym für die „Gastarbeiter*innen“ im Land.
Von „Fremdarbeiter*innen“ zu „Gastarbeiter*innen“
Diese wurden in den 1960er-Jahren über zwischenstaatliche Verträge aus Spanien, dem damaligen Jugoslawien und der Türkei nach Österreich geholt, um den Arbeitskräftemangel vor allem im Niedriglohnsektor auszugleichen. Basis dafür war das sogenannte Raab-Olah-Abkommen von 1961, in dem Gewerkschaftsbund und Wirtschaftskammer unter anderem „Fremdarbeiterkontingente“ für die systematische Öffnung des Arbeitsmarkts beschlossen. Der äußerst negativ konnotierte Terminus „Fremdarbeiter*in“ stammte noch aus der NS-Zeit, er war eine Bezeichnung für die damaligen Zwangsarbeiter*innen.
1973, das Jahr des Kolaric, ist auch der Zeitpunkt, in dem die Beschäftigung von „Gastarbeiter*innen“ mit rund 230.000 Personen einen Höhepunkt erreicht – fast neun Prozent des gesamten Arbeitskräftepotenzials in Österreich. Kurz darauf folgt mit dem Anwerbestopp, ausgelöst durch die Ölkrise und die damit verbundene Wirtschaftsflaute, eine Zäsur. Jedoch führt diese nicht wie erwartet zu einer Rückkehr der Arbeitsmigrant*innen in ihre Herkunftsländer. Im Gegenteil: Die „Gastarbeiter*innen“ holen ihre Familien nach und werden in Österreich sesshaft. Dennoch sinkt bis 1984 die Zahl der migrantischen Arbeitskräfte um beinahe 40 Prozent.
Noch immer wird die Geschichte der „Gastarbeiter*innen“ als „Minderheitengeschichte“ gelesen. Zudem tauchen sie in der offiziellen Erzählung so gut wie nie als aktiv handelnde Subjekte auf. Das herrschende Narrativ lautet vielmehr: Ausländische Arbeiter*innen wurden für den Wiederaufbau und den Wirtschaftsaufschwung gerufen und folgten dem Appell des österreichischen Staates in Scharen. Man kennt die Fotografien von vollen Bussen und Bahnhöfen und „dankbaren“ ankommenden Arbeitsmigrant*innen – abseits davon erzählen die Bilder aus den Medien jener Zeit aber nur wenig von den Erfahrungen der zugewanderten Menschen selbst. Etwa darüber, unter welchen schwierigen Bedingungen sie arbeiteten und lebten. Oder wie sie den Rassismus in der österreichischen Gesellschaft – mitsamt seinen Kontinuitäten der NS-Zeit – erlebten. Oder auch, wie sie sich gegen Benachteiligungen und Ausschlüsse zur Wehr setzten.
Wilde Streiks
Expliziter Protest manifestierte sich in unter anderem in Form von Streiks. In Deutschland ist 1973 als das Jahr der „wilden Streiks“ bekannt – also der Arbeitsniederlegungen, die nicht durch Gewerkschaften und Streikrecht abgesegnet waren. Viele davon wurden von Migrant*innen initiiert und getragen. Zu den bekanntesten gehören der Streik bei Ford Köln sowie jener beim Autozulieferer Pierburg in Neuss, der von migrantischen Arbeiterinnen angeführt wurde. Die streikenden „Gastarbeiter*innen“ forderten nicht nur angemessene Löhne und ein Ende der Lohnungleichheit, sondern auch allgemeine Verbesserungen am Arbeitsplatz wie zum Beispiel das Recht auf Pausen bei der Fließbandarbeit oder die Herabsetzung der Bandgeschwindigkeit. Oft gingen die Forderungen über den Betrieb hinaus und thematisierten auch prekäre Wohnverhältnisse sowie politische und gesellschaftliche Teilhabe.
Nur wenigen ist bekannt, dass es auch in Österreich wilde Streiks gab, an denen Migrant*innen wesentlich beteiligt waren: in der Polstermöbelfabrik Hukla in Wien 1974, bei der Tischlerei Kaufmann in Reuthe 1972 oder, ebenfalls 1972, beim Lichttechnik-Unternehmen Zumtobel in Dornbirn, wo neben Lohnforderungen auch die schlechten Wohnbedingungen in den „Gastarbeiterquartieren“ auf der Agenda standen. Ebenso sind die Streiks beim Isospan-Werk in Obertrum 1965 oder bei einer Baufirma in Admont 1966 zu nennen.
Kolaric und die Gewerkschaft
Selbstorganisierung und Protest gehörten demnach von Beginn an zur Geschichte der „Gastarbeiter*innen“ – ein Umstand, der nicht zuletzt bei den Gewerkschaften selbst nur wenig Anerkennung findet. Überhaupt zeigt sich das Verhältnis der Gewerkschaften zu Migration bis heute höchst zwiespältig und schwankt zwischen internationalistischem Anspruch und Solidaritätsbekundungen einerseits, der Vertretung einer nationalstaatlich organisierten Arbeitnehmer*innenschaft samt „Schutz“ des heimischen Arbeitsmarkts andererseits. Erst im Juni äußerte Josef Muchitsch als neuer Vorsitzender der sozialdemokratischen Gewerkschafter*innen beim ÖGB-Bundeskongress: „Eine Willkommenskultur ohne Wenn und Aber wird es in Zukunft nicht geben.“
Auch beim berühmten Kolaric-Plakat tun sich Ambivalenzen auf. Es verweist auf ein Gleichheitsideal, indem an eine gemeinsame (Namens-)Herkunft erinnert wird – und damit an eine mögliche Solidarität. Zugleich wird die eigene Betroffenheit ausgelagert: Die Frage „Warum sogns’ zu dir Tschusch?“ richtet sich an den „Fremden“, aber nicht an jene, von denen die Demütigung ausgeht. Vor dem Hintergrund, dass es sich bei der Kampagne um eine Initiative der Wirtschaft handelte, fügt sich „der Kolaric“ wiederum gut in den Diskurs über die Nützlichkeit von Gastarbeiter*innen ein (etwa symbolisiert durch die sehr großen Hände, die Tüchtigkeit und Fleiß suggerieren).
Hätte Kolaric selbst gesprochen, was hätte er dem Jungen wohl gesagt? Vielleicht lässt sich das, was 1991 eine weitere antirassistische Plakatkampagne in Referenz auf Kolaric formulierte, als Antwort lesen: Unter dem Titel „Sag noch einmal Tschusch“ schauen zwei stolze Migrant*innen den Betrachter*innen in die Augen. Indem sie den Blick umkehren, beanspruchen sie einen Subjektstatus, der den „Kolarics“ von damals noch verwehrt blieb.