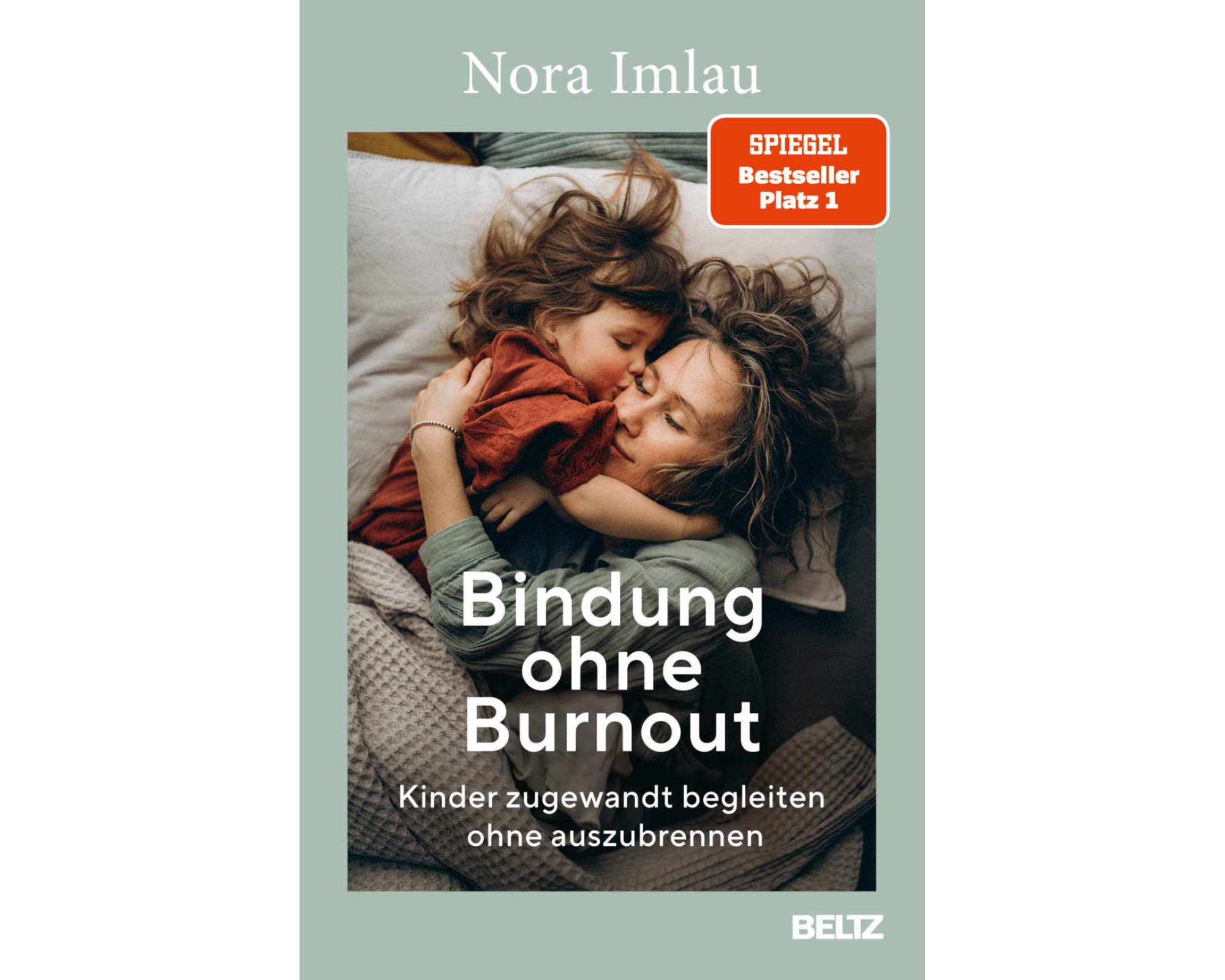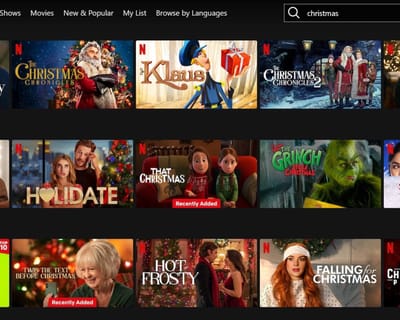Medien sind nicht der Endgegner
Kinder und Bildschirmzeit – das ist ein Thema, das viele Eltern verunsichert. Die Autorin Nora Imlau plädiert für mehr Gelassenheit. Ein Auszug aus ihrem jetzt erschienenen Buch „Bindung ohne Burnout“.
Kinder und Bildschirme: Zu kaum einem Thema erreichen mich mehr Fragen, und bei kaum einem Thema begegnen mir mehr Schuldgefühle. Kinder in sämtlichen Industriegesellschaften verbringen heute früher und länger Zeit vor Bildschirmen denn je – und es gibt Expert*innen, denen das Sorgen bereitet. Denn, klar: Für die kindliche Entwicklung ist es sehr wichtig, dass Kinder sich bewegen, spielen, toben. Sie machen alle möglichen Sinneserfahrungen sowie lebendige Beziehungserfahrungen mit ihren Eltern und anderen großen und kleinen Menschen. Sitzen sie stattdessen jeden Tag viele Stunden vor dem Fernseher oder dem Tablet, fehlt ihnen wertvolle Zeit für genau diese Erfahrungen.
Gleichzeitig ranken sich um das Thema Bildschirmkonsum im Kindes- und Jugendalter unglaublich viele Ängste, Dogmen und Mythen, insbesondere bei uns im deutschsprachigen Raum. Nirgendwo ist der Blick auf Kinder, die fernsehen, unentspannter.
Im deutschsprachigen Raum gibt es eine lange Tradition, besonders kulturpessimistisch auf neue Medien zu schauen.
Warum das so ist? Das hat mehrere Gründe. Zum einen gibt es im deutschsprachigen Raum eine lange Tradition, besonders kulturpessimistisch auf jeweils neue Medien zu schauen. Im 18. Jahrhundert stand beispielsweise das Lesen in der Kritik. Eltern sprachen sich mit Verve dafür aus, es ihren Kindern in der Schule nicht beizubringen, sondern sie weiterhin alles, was sie wissen müssten, auswendig lernen zu lassen. Denn wenn ein Mensch erst mal lesen kann, kann man ja nicht mehr kontrollieren, wie viel und was er alles liest – gefährlich! Eine große Befürchtung war auch, Lesen könne süchtig machen, ja, Menschen könnten eine regelrechte „Lesewut“ entwickeln, mit unabsehbaren Folgen. (...)
Später wiederholten sich diese Vorbehalte in vielen Varianten: gegenüber Tageszeitungen, dem neuen Medium Radio, dann dem Film, dann dem Fernsehen. Die Argumente ähnelten sich stets: Es bestehe eine Suchtgefahr, die Jugend könnte verdorben werden, eine Entfremdung von der Natur sei unvermeidlich. Während es in vielen Gesellschaften derlei Debatten gab, wurde im deutschsprachigen Raum die Angst vor neuen Medien auch deshalb so besonders groß, weil mit dem Erstarken der von Rudolf Steiner begründeten Anthroposophie zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine besonders medienkritische Weltanschauung beträchtlichen Einfluss erlangte.
In der Anthroposophie wird davon ausgegangen, dass Menschen für ihre seelische Entwicklung und Inkarnation unmittelbare Erfahrungen brauchen und jedes Medium letztlich zwischen einem Menschen und seiner Umwelt steht. Steiner bemerkte 1923 im vierten Teil seiner Vortragsreihe „Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Menschenerkenntnis“ über das Lesen in der Schule: „Da ist man schon ein richtiger Duckmäuser, da strengt sich nur noch ein Teil des Menschen an, der Kopf.“
Kinder unter drei brauchen keine Bildschirmzeit. Auch Vier-, Fünf- und Sechsjährige brauchen kein Fernsehen. Aber schadet es ihnen deshalb?
Diese Einstellung strahlt – zusammen mit den Stimmen einiger sehr bekannter Bildschirmkritiker – massiv in die Gesellschaft aus. Viele Eltern bekommen bei einer der ersten U-Untersuchungen ihres Kindes beispielsweise einen Flyer der Initiative „Bildschirm- frei bis 3“ in die Hand gedrückt, die sie für die Gefahren des frühen Bildschirmkonsums sensibilisieren soll. Ein vollständiger Verzicht auch über den dritten Geburtstag hinaus sei wünschenswert. Die Initiative wird vom Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte unterstützt, die Leitung haben jedoch zwei Mediziner*innen der anthroposophischen Hochschule Witten/Herdecke inne, die sich auf ihrer Website offen zu ihren anthroposophischen Grundwerten bekennen.
Daran ist im Prinzip nichts auszusetzen – nur stellt sich eben die Frage, ob Menschen, die qua ihrer spirituellen und weltanschaulichen Überzeugungen grundsätzlich extrem medienkritisch geprägt sind, wirklich einen offenen, objektiven Blick auf die tatsächlichen Folgen frühkindlichen Bildschirmkonsums haben. Die sind nämlich, wenn man sämtliche neueren Forschungsergebnisse betrachtet, lange nicht so dramatisch wie im deutschsprachigen Raum gerne dargestellt und kommuniziert.
Klar: Kinder unter drei brauchen keine Bildschirmzeit. Auch Vier-, Fünf- und Sechsjährige brauchen kein Fernsehen. Aber schadet es ihnen deshalb? Kommt drauf an. Eine der größten und umfassendsten Untersuchungen zu diesem Thema stammt von Dylan B. Jackson von der Universität Texas und wurde 2018 veröffentlicht. Diese Studie besagt: Es gibt zwar Hinweise darauf, dass intensiver Medienkonsum für Kleinkinder ungesund sein kann – doch das gilt vor allem in Kombination mit anderen problematischen Faktoren.
Ein Kind, das in einem liebevollen, kommunikativen Elternhaus mit vielfältigen Sinneserfahrungen groß wird, also im Alltag jede Menge spielt und liest und singt und lacht und buddelt und backt und rennt, kann kaum so viel „Bobo Siebenschläfer“ gucken, als dass ihm das schaden könnte.
Zugespitzt zusammengefasst: Ein Kind, das ohne Gespräche, ohne Kuscheln, ohne Vorlesen, ohne Spielen und ohne Naturerfahrung quasi allein vor nicht kindgerechten Sendungen aufwächst, hat ein echtes Problem. Umgekehrt kann ein Kind, das in einem liebevollen, kommunikativen Elternhaus mit vielfältigen Sinneserfahrungen groß wird, also im Alltag jede Menge spielt und liest und singt und lacht und buddelt und backt und rennt, kaum so viel „Bobo Siebenschläfer“ gucken, als dass ihm das schaden könnte. Warum setzt sich dann ein Hirnforscher in Talkshows und erzählt dort, dass Medienkonsum für kleine Kinder „wie Heroin“ sei und Gehirne schrumpfen lasse? Weil er es kann, und weil er wissenschaftliche Forschungsergebnisse so auswählt und zurechtbiegt, dass sie seine kulturpessimistischen Thesen stützen. Und weil es Quote bringt. Eltern schlecht zu machen dafür, wie sie heute mit ihren Kindern umgehen, zieht schließlich immer – vor allem bei der Großelterngeneration, die sich dann auf die Schulter klopfen kann, die eigenen Kinder auch ohne Apps und YouTube großbekommen zu haben, weil es die damals eben noch gar nicht gab.
Bildschirmzeit – Wie lange und wie oft?
Während mein erstes Kind vor 16 Jahren in seinen ersten drei Lebensjahren kaum Bildschirmmedien kannte, wusste mein drittes Kind zehn Jahre später schon mit anderthalb, wie man Fotos auf dem Smartphone mit den Fingern vergrößert und wo es auf Papas Handy zu den Maus-Clips geht. Heute ist dieses Kind sieben und navigiert selbstbewusst durch seinen eigenen Netflix-Account. Medienerziehung ist einfach viel komplexer geworden.
Ist das gut? Ist das schlecht? Es ist vor allem: anders. Mussten unsere eigenen Eltern uns höchstens ermahnen, nach der »Sesamstraße« den roten Aus-Knopf zu drücken und nicht die teure Telefonnummer bei »Wetten, dass ...?« zu wählen, stehen wir mit unseren Kindern vor der Herausforderung, irgendwie die permanente Verfügbarkeit einer unerschöpflichen Auswahl von Kindersendungen und -Apps zu händeln, die kein natürliches Ende kennt. Wo nach einer Folge der Lieblingssendung sofort die nächste anfängt, ist Abschalten schwieriger geworden. Setzen wir dabei auf feste Regeln, oder entscheiden wir je nach Situation? Darf unser Kind selbst entscheiden, wann Schluss ist, oder ist das unsere Verantwortung?
Wie groß die Angst vor den kleinen Bildschirmen ist, erlebe ich im Alltag immer wieder: Die nettesten Eltern können nämlich ganz schön ungemütlich werden, sobald ihr Kind ihrer Ansicht nach zu viel Zeit im Internet verbringt. Da werden Tablets weggesperrt, WLAN-Passwörter geändert, radikale Verbote verhängt – alles aus Sorge.
Vertrauen statt Angst – das ist unser Medien-Motto.
So ist es kein Wunder, dass Kontroll-Technologien zur punktgenauen Überwachung des kindlichen Medienkonsums boomen. Dann schaltet sich das Handy nach zwanzig Minuten ohne Diskussion einfach von allein aus, das Tablet schickt über jede Aktivität eine Meldung ans elterliche Smartphone, und selbst Chatverläufe und Suchhistorien auf Kinderhandys können über das Master-Passwort auf einem anderen Gerät mitgelesen und nachverfolgt werden. Klingt genial einfach – hat aber einen Haken: So überwacht zu wer den, vermittelt Kindern schnell das Gefühl, Mama und Papa würden ihnen nicht vertrauen. Wofür bräuchten sie sonst all die Technik?
Mit unseren Kindern setzen wir deshalb auf einen anderen Weg. Sie dürfen in einem ziemlich weit gesteckten Rahmen selbst entscheiden, wie lange sie welche Medien nutzen wollen – aber wir lassen sie dabei nicht allein, sondern begleiten sie. Das kann durchaus auch mal bedeuten, dass wir einen ganzen Nachmittag lang mit einem unserer Kinder eine neue App erkunden.
Haben wir das Gefühl, dass unsere Kinder zu viel am Handy hängen, sprechen wir mit ihnen darüber. Bereitet uns ihr »Minecraft«-Konsum Sorgen, suchen wir gemeinsam nach einer Lösung. Und lässt sich unser Kleiner von seiner Lieblingsserie kaum noch loseisen, drücken wir nicht einfach auf den Aus-Knopf, sondern setzen uns dazu, reden mit ihm über das spannende Geschehen da auf dem Bildschirm und locken ihn dann behutsam aus der Serienwelt zurück in unsere Wirklichkeit: „Komm, wir gehen Kaninchen füttern!“
Zum Weiterlesen:
Hier findest du unser Interview mit Nora Imlau.
Vertrauen statt Angst – das ist unser Medien-Motto. Ja, manchmal sitzen unsere Kinder länger vorm Bildschirm, als es für ihr Alter empfohlen wird. Und dann gibt es wieder Tage, da bleiben alle Geräte aus: weil das Wetter so gut ist, das neue Laufrad so spannend und das gemeinsame Grillen im Garten so viel verlockender als jede App. Und beides ist okay. Finde ich zumindest.
Holt mich die deutsche Medienangst dann doch mal wieder ein, denke ich an unsere Freunde in London, die aus Italien und dem Iran, Indien und Griechenland stammen und in deren Kindheit ausnahmslos der Fernseher lief. Von morgens bis abends, jeden Tag. Heute sind all diese Menschen wunderbare, liebenswerte Erwachsene mit beeindruckenden Lebensläufen, spannenden Jobs und eigenen Kindern – und das Abschalten von Lieblingsserien fällt ihnen großteils leichter als zum Beispiel mir, die mit ganz begrenztem Zugang zu Bildschirmmedien aufgewachsen ist.
Erste (Medien-)Hilfe für Eltern
Worauf in der Diskussion um Bildschirmzeit für kleine Kinder aus meiner Sicht viel zu wenig eingegangen wird, ist die akute Entlastung für Eltern. Das Bild der Mutter, die ihr Kind vor dem Fernseher parkt, statt sich aktiv mit ihm zu beschäftigen, gilt immer noch als Antithese zu allem, was gute Elternschaft ausmacht. Aber ist es das wirklich? Ich erlebe in meiner Arbeit sehr viele sehr engagierte, bemühte, liebevolle Mütter, die sich nicht trauen, ihr Kind zwischenzeitlich mal etwas gucken zu lassen und sich währenddessen auszuruhen – und die auch deshalb kurz vorm Burnout stehen.
Natürlich sind Bildschirmmedien nicht das einzige Mittel zur Burnout-Prophylaxe bei jungen Eltern, und womöglich ist es auch nicht das beste. Doch zumindest in meiner Wahrnehmung ist es oft das einzige, das erschöpften Eltern akut und ad hoc zur Verfügung steht. Ich finde es mehr als legitim, diese Entlastungsmöglichkeit dann auch zu nutzen – und zwar ohne schlechtes Gewissen.
„Mums need breaks“, sagte unsere britische Hausärztin dazu ganz pragmatisch. „Mütter brauchen Pausen. Und Peppa Pig ist ein prima Babysitter währenddessen.“
Dieser Text ist ein gekürzter Auszug des Kapitels „Medien sind nicht der Endgegner“ aus Nora Imlau „Bindung ohne Burnout. Kinder zugewandt begleiten ohne auszubrennen.“ Beltz Verlag, 2024 (205 S., 20 Euro)